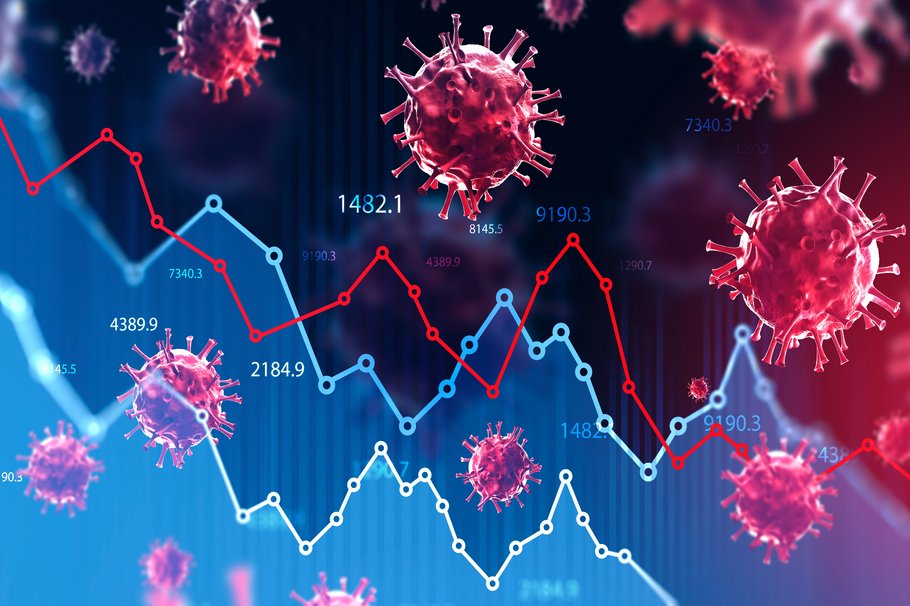Nicht zum ersten Mal greift ein Virus in den Lauf der Dinge ein. Covid-19 zwingt uns innezuhalten, nachzudenken und abzuwägen: Wie weit und wohin wollen wir noch gehen? Was in unserem Leben ist nötig, was ist überflüssig? Wie viel Sicherheit wollen wir, wie viel Risiko können wir uns leisten?
Die RiskNET-Redaktion sprach mit Klaus Heilmann, Arzt und emeritierter Professor der Medizin an der Technischen Universität München und international bekannter Experte für die Bewertung von Arzneimittelrisiken sowie Krisen- und Technikkommunikation.
Es wird deutlich, dass sich die aktuelle Corona-Pandemie hinsichtlich ihrer globalen Dimension in nichts von Pandemien früherer Zeiten unterscheidet. Den wesentlichen Unterschied zu heute sieht Klaus Heilmann aber darin, dass es damals noch keine Pandemie der Information gab.
Sie waren Professor der Medizin an der TU München und praktizierender Arzt. Was war der Anstoß, dass Sie sich mit den Risiken unseres täglichen Lebens, der mitunter schiefen Risikowahrnehmung und der Risikokommunikation in Medien, Wissenschaft und Politik beschäftigt haben?
Klaus Heilmann: Im Laufe meiner wissenschaftlichen Tätigkeit in einem hoch spezialisierten medizinischen Fach war ich irgendwann zu der Erkenntnis gelangt, dass meine Problemlösungen nicht nur im eigenen, sondern auch in anderen Fachgebieten zu finden sind. Ich begann Fachgrenzen zu überschreiten, was den Kollegen im eigenen Fach nicht gefiel, denen anderer Disziplinen auch nicht. Und im Gegensatz zu Kollegen in den USA, wohin ich mich schon Anfang der 1970er Jahre aufgemacht hatte, wurde ich in Deutschland für meine Grenzüberschreitungen ins Abseits gestellt, sodass ich mich schließlich zu Beginn der 1980er Jahre entschloss, dem deutschen Universitätswesen den Rücken zu kehren und in eigener Praxis selbständig und damit unabhängig zu werden. So war der Anfang. Der eigentliche Anlass aber, mich mit Fragen der Risikoabschätzung- und Wahrnehmung zu beschäftigen und Risikokommunikation zu einem Schwerpunkt meiner späteren Arbeit zu machen, war eine Einladung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, auf seinem Kongress "Industriegesellschaft und technologische Herausforderung" über Auswirkungen technischer Innovationen auf die Medizin zu sprechen.
Ihre Erfolge und ihre Bekanntheit in Industrie und Wirtschaft beruhten also vor allem auf dem Umstand, dass Sie – wie Sie selbst von sich sagen – ein Generalist waren, und eben nicht ein Spezialist und sich zudem Laien verständlich machen konnten.
Klaus Heilmann: Ja, vor allem, aber nicht nur. Meine Arbeit auf dem Gebiet von Krisen-Management und Risikokommunikation führten dazu, dass ich nicht nur in den Industrien, sondern auch in den Medien immer bekannter wurde. Kaum eine Krise in den 1980-er Jahren – ich denke an die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, den Chemieunfall von Schweizerhalle und an zahlreiche Arzneimittelzwischenfälle – in die ich nicht von einem Unternehmen oder Verband eingebunden wie auch von den Medien befragt worden wäre, wobei jeder versuchte, mich mit meinen Meinungen auf seine Seite zu ziehen. Bis mir eines Tages klar wurde, dass das Interesse an mir nicht allein darauf beruhte, dass ich von sehr unterschiedlichen Dingen etwas verstand und Probleme besonders auch Laien verständlich machen konnte, sondern vor allem darauf, dass ich wirklich unabhängig war. Ich trug kein Firmenschild am Revers und konnte somit ohne jegliche Rücksichtnahme sagen, was ich für richtig oder falsch, notwendig oder überflüssig hielt. Und so ist es bis heute geblieben. Neutral aber war und bin ich nicht, denn nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass wir ohne Wissenschaft und Forschung, ohne innovative Technologien, neue Techniken und auch Mut zum Risiko weder unseren heutigen Lebensstandard aufrecht und an andere weitergeben noch die weltweit anstehenden Gegenwarts- und Zukunftsprobleme bewältigen können.
Die Statistik zeigt uns unmissverständlich, dass wir in unserer Gesellschaft immer sicherer leben und die durchschnittliche Lebenserwartung höher ist als bei jeder Generation vor uns. Wir leben in der Regel immer risikoärmer und fürchten uns trotzdem vor Elektrosmog, Kriminalität, Finanzkrisen, Viren, Pestizidrückständen, Antibiotika oder Hormonen in Fleisch, gentechnisch veränderten Lebensmitteln und chemischen Konservierungsmitteln. Was sind die Gründe für diese mitunter schiefe Risikowahrnehmung?
Klaus Heilmann: Nun haben Sie da recht unterschiedliche Gefahren genannt, sowohl was deren Schädigungspotenzial betrifft als auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese für uns irgendwann einmal zum Problem werden. Dennoch, da haben Sie völlig recht: wir leben immer sicherer – heute in der sichersten aller Zeiten überhaupt – und werden dennoch immer unsicherer und ängstlicher. Für die Risikowahrnehmung jedes Ihrer Beispiele gibt es unterschiedliche Erklärungen, aber eine ist allen gemeinsam: Sicherheit ist nicht nur ein angestrebtes Ziel, sondern selbst auch eine Gefahr. Denn je sicherer wir leben, umso gefährlicher leben wir auch, weil wir nicht mehr darauf vorbereitet sind, dass uns etwas passieren kann. So wie mit der Zeit unser Leben immer sicherer und damit zur Selbstverständlichkeit wurde, so wird unter Sicherheit heute zunehmend eine absolute Sicherheit verstanden, und die gibt es nun einmal nicht. Vor allem aber müssen wir verstehen lernen, dass Sicherheit nicht etwas ist, was man einmal erreicht hat und dann ein für alle Mal besitzt, sondern etwas, was ständig wieder aufs Neue erreicht werden muss.
Die wahren Lebensrisiken sind vor allem die Risiken, die wir selbst beeinflussen können. Die globale Langzeitstudie "Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017" zeigt beispielsweise unmissverständlich, dass jeden Jahr rund 11 Millionen Menschen in der Folge ungesunder Ernährung versterben. Und rund 7,2 Millionen Menschen versterben weltweit an den Folgen des Rauchens. Warum beschäftigen sich Menschen nur unzureichend mit den echten Lebensrisiken, die sie selber stark beeinflussen können?
Klaus Heilmann: Von den von Ihnen genannten Beispielen ist Rauchen insofern besonders interessant, als es exemplarisch zeigt, wie wir uns oft selbst betrügen. Das lebensverkürzende Risiko der Zigarette kann für einen starken Raucher mit etwa acht Lebensminuten angegeben werden. Diese Zahl beeindruckt ihn aber nicht, und so rechnet er sich aufgrund seines täglichen Zigarettenkonsums die Zahl der Jahre aus, um die sein Leben verkürzt wird, zieht sie dann von seiner statistischen Lebenserwartung ab und findet sich schließlich damit ab, ein paar Jahre weniger zu leben. Eine Versicherungsgesellschaft – wie auch das Leben selbst – stellt die Rechnung allerdings anders auf: Sie präsentiert zusätzliche Versicherungsprämien für erhöhtes Risiko nicht erst am Ende des Lebens, sondern sofort, indem sie beispielsweise dem chronologischen Lebensalter eine bestimmte Zahl von Jahren hinzufügt. Dieses sogenannte Risikoalter ermitteln die Versicherer, indem sie die Summe aller mit Risiken verbunden Aktivitäten bilden, um dann aus der sich hieraus ergebenden Zahl in ihren Standard-Lebensversicherungstabellen das zugeordnete Alter abzulesen. Für den Versicherungsnehmer bedeutet dies, dass er wegen seines Rauchens sofort um einige Jahre älter wird, als er nach seinem Geburtsdatum eigentlich ist, und dies gilt nicht nur für den Versicherer, sondern auch biologisch.
Rauchen ist nur ein Beispiel von vielen und die Schlussfolgerung hieraus kann für uns alle eigentlich nur die sein, diejenigen Gesundheitsgefahren herauszufinden, die lebensverkürzend aber auch von uns selbst zu beeinflussen sind, und diese dann zu reduzieren oder ganz zu meiden.
In Ihrem neuen Buch „Im Ozean der Ungewissheiten" zählen Sie eine Reihe von Pandemien aus der Vergangenheit auf, die aus dem Gedächtnis der meisten Menschen getilgt wurden. Was sind die Gründe für diese Vergesslichkeit?
Klaus Heilmann: Diejenigen Pandemien, die wie die Spanische Grippe niemand von uns erlebt hat, sind Geschichte. Und für die Menschen, die wie ich die Pandemien der Jahre 1957 /58 und 1968/1970 persönlich erlebt haben, sind diese mittlerweile auch Geschichte. Sie sagen uns nichts mehr, weil wir aus dem Gestern für uns heute wenig bis nichts lernen können, zu unterschiedlich waren damalige Zeiten und die Möglichkeiten, Krankheitsgefahren zu erkennen und sie zu bekämpfen.
Ereignisse der Vergangenheit sind nun einmal nur soweit für uns heute von Interesse, als wir aus ihnen auch Nutzen für uns ziehen können. Und so glaube ich, dass wegen des zu erwartenden enormen Zuwachses an Wissen auch die gegenwärtige Pandemie aus dem kollektiven Gedächtnis der nach uns kommenden Generationen eines nicht fernen Tages wieder weitgehend verschwinden wird.
Warum sind aus Ihrer Sicht viele Menschen auf der Suche nach dem "Nullrisiko"?
Klaus Heilmann: Weil Wissenschaft, Politik und Medien den Menschen zwar sagen, dass es absolute Sicherheit nicht gibt, das "Warum" aber nicht wirklich überzeugend klar machen. Viele Menschen glauben deshalb, dass hundertprozentige Sicherheit auch tatsächlich möglich ist, ja, sie erwarten sie sogar. Deshalb zeigt der einzelne, wenn es um Risikoentscheidungen geht, in die er selbst nicht eingreifen kann, eine Nullrisiko-Mentalität und erwartet, dass diejenigen, die für Entscheidungen zuständig sind, auch bestraft werden, wenn diese sich als falsch herausstellen sollten.
Anders hingegen die Situation, wenn wir selbst entscheiden können und auch glauben, die richtige Wahl zu treffen. Dann sind wir durchaus risikofreudig. Denn der Mensch meidet nicht nur Risiken, er sucht sie auch, und zwar um so häufiger und gewagter – man denke nur an die heute bei uns ausgeübten Extremsportarten – je sicherer die Zeiten sind und je sicherer er sich fühlt. Und, möchte ich hinzufügen, je höher der allgemeine Lebensstandard ist, den er hat. Denn sein Leben mit Mountain-Biking, Freeclimbing und Base-Jumping freiwillig aufs Spiel zu setzen, das muss man sich auch leisten können.
In der Wissenschaftskommunikation kann sich der Wissende nicht mehr auf sein Wissen berufen, weil der Unwissende das Wissen nicht mehr als Kriterium anerkennt. Die Diskussionen rund um die Risikobewertung von SARS-CoV-2 haben gezeigt, dass viele Wissenschaftler nicht mehr zu einem Diskurs fähig sind, sondern Andersdenkende diskreditieren.
Klaus Heilmann: Dass der Unwissende Wissen nicht mehr als Kriterium anerkennt, ist verständlich und den Wissenschaftlern anzulasten, denen es nicht gelungen ist, ihr Wissen Laien, soweit es für diese relevant ist, näher zu bringen. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, nämlich das durch Medien und Internet verbreitete Halbwissen, welches Laien glauben lässt, dass die ihnen vermittelten Informationen bereits genügen, um überall mitreden zu können. Dass die pandemiebedingten Diskussionen aber auch zeigen, dass – wie Sie sagen – viele Wissenschaftler nicht mehr zu einem Diskurs fähig sind, sondern Andersdenkende diskreditieren, kann ich leider nur bestätigen, habe ich doch als Generalist ständig damit zu kämpfen.
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang überhaupt die Rolle der "Experten" aus der Wissenschaft?
Klaus Heilmann: Genauso, wie ich sie in meinem Buch beschrieben habe. So wie die meisten sind auch die während der Krise aufgetretenen Wissenschaftler Experten, die auf einem speziellen Gebiet – zum Beispiel der Epidemiologie, Virologie oder Hygiene – ein überdurchschnittliches Wissen besitzen, dass sie Fachleute eines Spezialgebiets sind, von dem sie viel verstehen und welches sie überblicken. Leider überblicken Sie nicht sehr viel, ihr Gesichtsfeld beträgt meist nur wenige Grad. Man nennt das einen Tunnelblick.
Und weil diese Experten ein zwar tiefes aber eben nur begrenztes Wissen haben, braucht man für Problemlösungen auch, wie wir in der gegenwärtigen Pandemie gesehen haben, sehr viele Experten und kommt man bei Entscheidungen nur langsam und manchmal gar nicht voran. Viele Tunnelblicke aneinander gereiht ergeben eben noch keinen Panoramablick.
Seit rund drei Jahrzehnten führe ich Risikoanalysen für technische, gesellschaftliche und ökonomische Fragestellungen durch. Hier habe ich gelernt, dass nur ein interdisziplinärer Dialog zu konsistenten Risikoszenarien führt, die dann die Grundlage für Maßnahmen bilden. Wieso gibt es diesen Dialog im Zusammenhang mit der Risikobewertung von Corona nicht? Ist es die Eitelkeit und das Geltungsbedürfnis der "Experten", die zu dieser dogmatischen Sicht und dem Diffamieren Andersdenkender führt? Warum gibt es bis heute kein interdisziplinäres Szenarioteam, das sich aus Risikoforschern, Epidemiologen, Virologen, Ökonomen, Psychologen, Kommunikationswissenschaftlern etc. zusammensetzt?
Klaus Heilmann: Ihre Feststellung, dass nur ein interdisziplinärer Dialog zu brauchbaren Risikoanalysen führt, kann ich nur bestätigen, haben wir das Gegenteil doch in der Corona-Krise eindrucksvoll erlebt. Als sich das RKI mit regelmäßigen Mitteilungen über den Stand der Pandemie an die Bevölkerung wandte, fingen Wissenschaftler im ganzen Land damit an, sich – gefragt wie ungefragt – mit ihren Erkenntnissen und Meinungen in die Diskussion einzubringen. Mit Hilfe der öffentlichen Medien – vor allem des Fernsehens mit seinen unsäglichen Talksendungen –, wie auch auf eigenen Internetkanälen wurden wir von einer Welle an Studien, Meinungen und Aussagen zu COVID-19 überspült, deren Qualität oftmals infrage gestellt werden musste und die gleichzeitig ein grelles Licht auf das Geltungsbedürfnis ihrer Urheber warfen.
Auch wenn die Bevölkerung immer wieder aufgerufen wird, an die Wissenschaft zu glauben, leicht macht es die Wissenschaft der Bevölkerung nicht. Und wenn Experten, wie wir es in der Pandemie erlebt haben, unfähig sind, die für die Öffentlichkeit relevanten Fragen möglichst einfach und vor allem identisch zu beantworten, so muss dies zwar nicht bedeuten, dass gesicherte Erkenntnisse in den Wissenschaften nicht vorhanden wären, aber es wird von der beunruhigten Bevölkerung doch so empfunden. Denn wird dem Bürger in der Krise die selbe Situation von dem einen Experten so dargestellt, als habe man sie im Griff, während der andere sie als außer Kontrolle geraten schildert, so muss er annehmen, dass keiner von beiden etwas genaues weiß und geht dann bei der eigenen Beurteilung der Lage zunächst von der schlechteren Alternative aus, eine, wie ich meine, nicht unverständliche Reaktion.
Unternehmen, die Risikomanagement ernsthaft, präventiv und wirkungsvoll betreiben, definieren zunächst einmal ihre Risikoakzeptanz, d.h. sie beantworten die Frage, wie viel Restrisiko man zu tragen bereit ist. Denn Unternehmen wissen, dass es eine 100%-Sicherheit nicht geben kann. Wieso definiert der Staat ein solches Restrisiko nicht für die Gesellschaft insgesamt?
Klaus Heilmann: So weit es allgemein verbindlich überhaupt möglich ist, hat dies der Staat getan. Vom Deutsche Bundesverfassungsgericht wurde 1978 Restrisiko so formuliert: "In der Gestaltung der Sozialordnung bei der Abschätzung von Risiken haben Maßstäbe der praktischen Vernunft zu gelten. Mehr zu fordern hieße, die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens ignorieren zu wollen. Ungewissheiten jenseits dieser Schwelle sind unentrinnbar und daher als sozialadäquate Lasten von allen Bürgern zu tragen." Restrisiko bedeutet hiernach also ein für zumutbar erklärtes, ein akzeptables Risiko. Isoliert verwendet ist aber die Qualifikation "Rest" nicht ohne weiteres verständlich und für Akzeptanzdiskussionen in der Öffentlichkeit ausgesprochen ungeeignet, denn sie erweckt den Eindruck, dass die Beseitigung eines Restrisikos doch möglich und absolute Sicherheit damit erreichbar sei, aber aus irgendeinem Grund – zum Beispiel weil zu teuer – nicht erfolgt.
Und bei Pandemien? Ist da im Zusammenhang mit COVID-19 ein akzeptables Restrisiko definiert worden oder verfolgte man das nicht erreichbare Ziel des Null-Risikos?
Klaus Heilmann: Welches Ziel man bei COVID-19 staatlicherseits verfolgte und wann und inwieweit Chance-Risiko-Abwägungen in Bezug auf die zu unternehmenden Maßnahmen angestellt wurden, entzieht sich meinen Kenntnissen. Sicher aber ist, dass solche Abwägungen immer dann schwierig sind, wenn man über die Gefahrensituation – in diesem Fall die Gefährlichkeit des SARS-CoV-2 Virus – wenig weiß, und auch heute noch weiß man über das Gefahrenpotential des Erregers und seiner Varianten nicht alles. Eingeschlagene Maßnahmen, die sich später als falsch erweisen, im Nachhinein zu kritisieren, wie dies verschiedentlich, auch von Seiten der Wissenschaften geschieht, ist jedenfalls nicht schwer, zeugt aber auch nicht von besonderem Sachverstand.
Mir ist in Ihrem Buch "Im Ozean der Ungewissheiten" aufgefallen, dass Sie – wie auch soeben – von Chance-Risiko-Abwägungen, ihre medizinischen Kollegen aber – wie beispielsweise bei den neuen Impfstoffen – von Nutzen-Risiko-Bewertungen sprechen.
Klaus Heilmann: Stimmt, und dies hängt sicher mit meinen Grenzüberschreitungen zusammen, bei denen ich von Nicht-Medizinern – Technikern, Ingenieuren, Chemikern – gelernt habe, für klare Zusammenhänge auch präzise Begriffe zu verwenden. Warum, also, spreche ich nicht von Nutzen-Risiko-Bewertung, mit der von den Kontrollbehörden das Verhältnis des Nutzens eines Arzneimittels oder eines Impfstoffs gegenüber dessen möglichen Risiken beschrieben wird?
Ich gebe ein Beispiel: Bei der Entscheidung, eine Straße zu überqueren, besteht die Chance darin, die andere Straßenseite zu erreichen, während das Risiko darin liegt, von einem Auto überfahren zu werden. Bei einem Impfstoff ist es nicht anders: Die Chance, mit ihm geimpft zu werden, liegt darin, dass man sich in Zukunft nicht infiziert und gesund bleibt – das ist der erhoffte Nutzen –, das Risiko besteht darin, dass die Impfung bei einem nicht wirkt oder man Nebenwirkungen durch sie erleidet – das ist der befürchtete Schaden. Nutzen und Schaden sind qualitative Werte, während Chance und Risiko quantitative Begriffe sind. Wenn man also bei einem neuen Impfstoff den von ihm zu erwartenden Nutzen gegen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Nebenwirkungen – die Risiko-Wahrscheinlichkeit – abwägt, dann vergleicht man in Wirklichkeit Unvergleichbares, nämlich den Nutzen einer Sache mit der Eintrittswahrscheinlichkeit für Schaden, also Qualitatives mit Quantitativem.
Abwägungen, wenn sie zu brauchbaren Ergebnissen führen sollen, erfordern aber, Gleiches mit Gleichem zu vergleichen, die Wahrscheinlichkeit für Nutzen mit der Wahrscheinlichkeit für Schaden.
Wir müssen uns also darüber im Klaren sein, dass es bei behördlichen Entscheidungen über einen neuen Impfstoff – wie über jedes neue Arzneimittel – immer um die Abwägung von Wahrscheinlichkeiten geht, nämlich um die Wahrscheinlichkeit des Eintreffen von Nutzen oder Schaden.
Die Verwendung korrekter Begriffe scheint Ihnen gerade auch in der Corona-Diskussion wichtig zu sein ...
Klaus Heilmann: Ja, sehr sogar, weil es für die Risikodiskussion mit der Bevölkerung wichtig ist, Begriffe richtig und, vor allem einheitlich zu verwenden, damit die Dinge, für die sie stehen, auch einheitlich und richtig verstanden werden. So ist es zum Beispiel auch irreführend, gefährlich und falsch, die Begriffe Risiko und Gefahr synonym zu benutzen, wie das sogar der Duden zulässt, denn der eine Begriff – Risiko – drückt etwas Quantitatives, der andere – Gefahr – hingegen etwas Qualitatives aus.
Gemeinsam mit John Urquhart, einem amerikanischen Wissenschaftler für Medizintechnik und Pharmaka-Epidemiologie, haben Sie bereits im Jahr 1983 nach dem Vorbild der Richterskala für Erdbeben eine "Sicherheitsskala" für technisch-zivilisatorische Risiken erstellt. Können Sie uns das Verfahren, welches dieser zugrunde liegt, kurz erläutern.
Klaus Heilmann: Es werden alle Menschen in einer Gruppe zusammengefasst, die mehr oder weniger dem gleichen Risiko ausgesetzt sind oder waren. Die Anzahl der Menschen in so einer Gruppe wird dann durch die Anzahl der Opfer geteilt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes – zum Beispiel während eines Jahres oder eines Ereignisses – auftreten. Das Ergebnis dieses einfachen Rechenvorgangs ergibt die Größe des Risikos, dem der einzelne ausgesetzt ist oder war. Eine Gruppe von Menschen, die durch ein bestimmtes gemeinsames Risiko charakterisiert ist und während eines festgelegten Zeitraums ein Opfer hervorbringt, nennen wir Risikogemeinschaft.
Die Verständlichkeit unseres Verfahrens, Risiko zu quantifizieren, beruht also auf der Gegenüberstellung von zwei Zahlen: Die Zahl 1 steht für das Opfer, man kann es selbst sein oder es ist ein anderer. Die andere Zahl bezeichnet die Größe einer Gruppe von Menschen, die ein bestimmtes Risiko miteinander teilen. Je größer so eine Risikogemeinschaft ist, umso stärker ist das Risiko für den Einzelnen "verdünnt", je kleiner die Gruppe, umso stärker wird das Risiko für ihn "konzentriert". Die Größe der Gruppe, in der man sich befindet, gibt einem also eine Vorstellung von der Größe des eigenen Risikos.
Weil nun zwischen den Größen von Risikogemeinschaften enorme Unterschiede bestehen, erschien es uns zweckmäßig, die Gruppengrößen, ähnlich der Richterskala, auf eine logarithmische und somit komprimierte Skala zu übertragen. Unsere Sicherheitsskala berücksichtigt Risikogemeinschaften von 1 bis 100.000.000 Menschen und bewegt sich zwischen null – geringste Sicherheit beziehungsweise höchstes Risiko – und acht – höchste Sicherheit beziehungsweise niedrigstes Risiko.
Mit jeder ganzen Zahl auf der Skala nach oben oder unten erhöht beziehungsweise vermindert sich die Sicherheit um das zehnfache. Während es mit null einen numerischen Wert für absolutes Risiko gibt, gibt es einen solchen Wert für absolute Sicherheit nicht, weswegen die Skala auch nach oben offen ist, um anzudeuten, dass Sicherheit nur angestrebt, nie aber völlig erreicht werden kann. Die Sicherheitsgrade auf unserer Skala stellen Maßeinheiten für Risiken dar, so wie die Werte auf der Richterskala Maßeinheiten für die Stärke der Energiefreisetzung bei Erdbeben sind.
Könnte man diese "Sicherheitsskala" auch für die Bewertung von COVID-19 verwenden?
Klaus Heilmann: Prinzipiell ja, und die Vielfältigkeit Ihrer Einsatzmöglichkeiten wurde uns auch im angloamerikanischen Schrifttum bestätigt. Da die Skala aber relativ unbekannt geblieben ist und die meisten Menschen mit logarithmischen Zahlen Schwierigkeiten haben, habe ich für mein Buch nur das der Skala zugrundeliegende "Eins-zu-Verfahren" verwendet und gezeigt, wie sich jedermann auch mit diesem und den während der Pandemie vom RKI veröffentlichten Zahlen selbst ein Bild darüber machen kann, wie hoch sein Risiko ist, sich mit dem Virus zu infizieren beziehungsweise als Infizierter an ihm zu sterben.
Sie glauben also, dass man Risiken prinzipiell auch Laien verständlich machen kann?
Klaus Heilmann: Vielleicht nicht allen, aber den meisten. Um ein Risiko in seinen quantitativen Dimensionen begreifen zu können, ist es nun einmal notwendig, dass es zahlenmäßig beschrieben wird. Eigentlich sollte es heute nicht mehr akzeptabel sein, Risiken nur mehr mit Begriffen wie "hoch" oder "niedrig" zu beschreiben. Und es ist für mich erstaunlich, dass wir als Bürger technologisch fortgeschrittener Länder Nachrichten über Risiken ohne jegliche Bezugsgröße überhaupt akzeptieren. Wenn viele ein wenig mehr von Risiken und ihren Dimensionen verstehen würden, könnten nicht wenige – seien es Politiker, seien es Wissenschaftler – vielen erzählen, für wie sicher oder gefährlich sie etwas halten.
Wie bewerten Sie also das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation der Politik während der Pandemie?
Klaus Heilmann: Für nicht besonders gut, möchte ich am liebsten sagen, würde mich dann aber denen zugesellen, die hinterher immer alles besser wissen. Dass sich unser Staat damit schwer tat, die von Seiten der Wissenschaften für sinnvoll erachteten Pandemie-Maßnahmen für die Gesellschaft auch akzeptabel durchzusetzen, ist durchaus verständlich, da diese höchst unterschiedlich waren und sich ständig änderten, so dass er letztlich nicht wissen konnte, auf wen er sich nun eigentlich verlassen sollte.
Andererseits ist es auch verständlich, dass sich Bürger eines freiheitlich-demokratischen Landes, denen es in wirtschaftlicher Hinsicht gut geht und die sich eigentlich sicher fühlen, schwer damit tun, rigorose, freiheitsbeschränkende Maßnahmen von Seiten des Staates so ohne weiteres hinzunehmen.
Dies gilt besonders dann, wenn man ihnen die Situation, in der sie sich befinden, nicht verständlich erklärt und ihnen den Sinn der Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen, nicht plausibel erläutert. Oder – und vor allem – wenn sie merken, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auch stark von politischen und wirtschaftlichen Interessen sowie – wie auch jetzt bei uns wieder zu beobachten – von anstehenden Wahlen beeinflusst werden.
Erinnern wir uns: Die alle überraschende Entscheidung zum plötzlichen Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergienutzung vor genau zehn Jahren geschah nicht nur unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Fukushima, sondern hing auch mit dem Erstarken der Partei der Grünen und den damals bevorstehenden Landtagswahlen in Deutschland zusammen.
Sie haben nun drei Pandemien persönlich erlebt. Worin, glauben Sie, unterscheidet sich COVID-19 von früheren Pandemien?
Klaus Heilmann: Darüber habe ich viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass sich die durch das SARS-CoV-2-Virus ausgelöste Pandemie hinsichtlich ihrer globalen Dimension in nichts von Pandemien früherer Zeiten unterscheidet, auch wenn diese sich geändert haben, die Welt heute nicht mehr die von gestern ist, und die Menschen von heute andere Sorgen und andere Hoffnungen haben als die Menschen von gestern. Pest und Syphilis, Pocken und Cholera verliefen ebenfalls tödlich. Doch gibt es zwischen damals und heute einen großen Unterschied: Die Welt war noch nicht globalisiert, nicht durch Internet und Mobiltelefone vernetzt, kannte noch keine Massenmedien, noch nicht die sozialen Netzwerke und noch nicht das Fernsehen. Vor allem aber: Es gab noch keine Pandemie der Information.
[Die Fragen stellte Frank Romeike]
Klaus Heilmann war Arzt, Professor der Medizin an der Technischen Universität München und ein international bekannter Experte für Arzneimittelrisiken sowie Krisen- und Technikkommunikation. Heute ist er als Autor und Publizist tätig.
Wissenschaftliche Forschungs- und Lehrtätigkeiten führten ihn nach Schweden, Spanien, in die Schweiz, die Sowjetunion und regelmäßig in die USA. Neben Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten (Boston, Philadelphia, San Francisco) war er viele Jahre Gastprofessor am Baylor College of Medicine, Hauston, Texas, sowie Consultant Scientist am Institute for Medical Engineering, University of California, Los Angeles.
Heilmann veröffentlichte mehr als 100 Fachartikel sowie über 30 Fachwerke und Bücher zu medizinischen, gesundheitstechnologischen und gesellschaftspolitischen Themen. Die meisten seiner wissenschaftlichen Bücher wurden in fremde Sprachen übersetzt, einige waren internationale Bestseller und Trendsetter. Durch Funk- und Fernsehbeiträge wurde er auch einem breiteren Publikum bekannt.
Heilmann beriet über ein Jahrzehnt Verbände, internationale Organisationen, multinationale Industrieunternehmen und Konzerne aller Sparten in Risiko- und Kommunikationsfragen, so auch 1986/87 die deutsche Chemische Industrie nach dem Chemieunfall in Basel und die deutsche Energiewirtschaft nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl.
Klaus Heilmann war Film- und Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Formatentwickler für ARD und ZDF. Vier Jahre lang moderierte er im deutschen Fernsehen einen wöchentlichen Expertentalk "Gesundheit" .